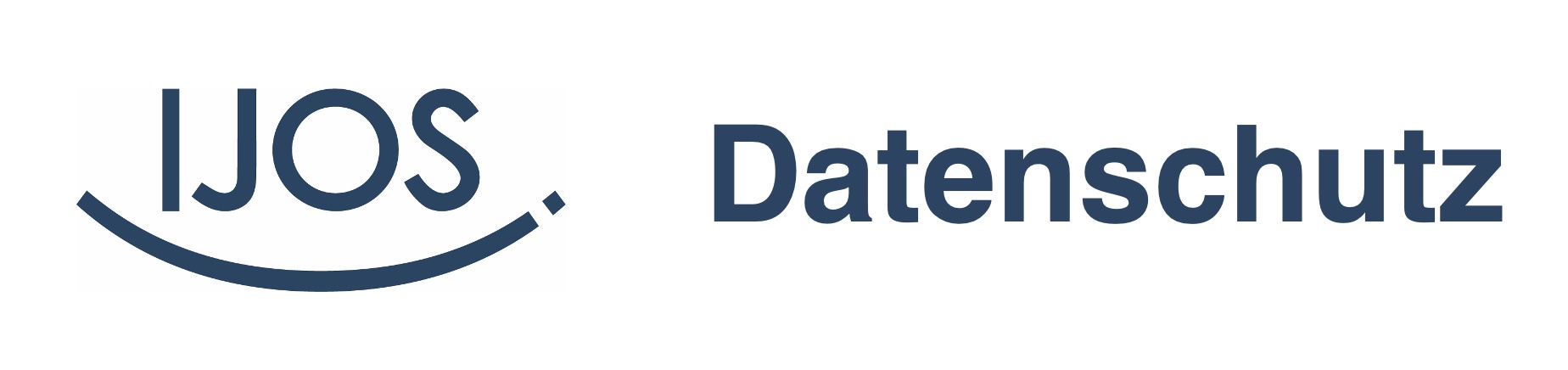Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdaten was geht und was schiefgehen kann
Digitalisierung im Gesundheitswesen
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet mit großen Schritten voran und bringt zahlreiche Veränderungen mit sich. 💡 Künstliche Intelligenz, Big Data und automatisierte Prozesse versprechen eine effizientere Versorgung, schnellere Diagnosen und einen besseren Zugang zu medizinischen Daten. Gleichzeitig wirft diese Entwicklung Fragen auf: 🔐 Wer kontrolliert die Gesundheitsdaten? Wie sicher sind sie? Und welche Rolle spielt der Mensch in einer zunehmend datengetriebenen Medizin?
Ein zentraler Treiber der Digitalisierung sind ⚖️ europäische Regulierungen, die einen gemeinsamen Gesundheitsdatenraum schaffen sollen. Die Verordnung zum „European Health Data Space“ (EHDS) wurde 2024 vom Europäischen Parlament verabschiedet und soll es Bürgerinnen und Bürgern erleichtern, 📂 ihre elektronischen Gesundheitsdaten zu verwalten. Gleichzeitig erhalten Forschung und politische Entscheidungsträger Zugang zu anonymisierten Daten, um Innovationen voranzutreiben. Ähnliche Regelungen existieren bereits für die Nutzung von KI im Gesundheitswesen – etwa der „AI-Act“, der den sicheren Einsatz von 🤖 Künstlicher Intelligenz in der Medizin regeln soll.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit einer 📁 digitalen Patientenakte könnten Behandlungen über verschiedene Einrichtungen hinweg besser koordiniert werden. 🩺 KI könnte in der Bildgebung helfen, Tumore oder andere Krankheiten früher zu erkennen. Auch administrative Prozesse ließen sich durch Automatisierung enorm verschlanken. In Deutschland etwa soll das 📜 E-Rezept den bisherigen Papierkrieg in Arztpraxen und Apotheken ablösen. Doch die Umsetzung läuft schleppend, auch weil 🖥️ technische Infrastrukturen oft veraltet sind und Akzeptanzprobleme bei medizinischem Personal bestehen.
Neben all diesen Chancen gibt es Risiken. 🔓 Gesundheitsdaten gehören zu den sensibelsten Informationen überhaupt – und sind damit ein begehrtes Ziel für Cyberkriminalität. Während Länder wie Estland auf 🔗 Blockchain-Technologien setzen, um Datensicherheit zu gewährleisten, zeigen Datenlecks in anderen Staaten, dass viele Systeme noch nicht ausreichend geschützt sind. Eine weitere Herausforderung ist der sogenannte ⚠️ „Bias“ in KI-Systemen: Wenn Algorithmen auf fehlerhaften oder unvollständigen Datensätzen trainiert werden, können sie fehlerhafte Diagnosen oder Behandlungsentscheidungen treffen.
Daher fordern Expertinnen und Experten, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht nur effizient, sondern auch 🧑⚖️ ethisch vertretbar gestaltet wird. Die sogenannten 📑 „FAIR-Principles“ sollen sicherstellen, dass Daten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable) sind – und dabei dennoch die 🔒 Privatsphäre der Betroffenen geschützt bleibt.
Ein interessanter Artikel von 📖 Prof. Dr. Brigitte Tag, erschienen in der Fachzeitschrift Medizinrecht (MedR), fasst die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen umfassend zusammen. Der Artikel ist frei zugänglich und kann gelesen werden.